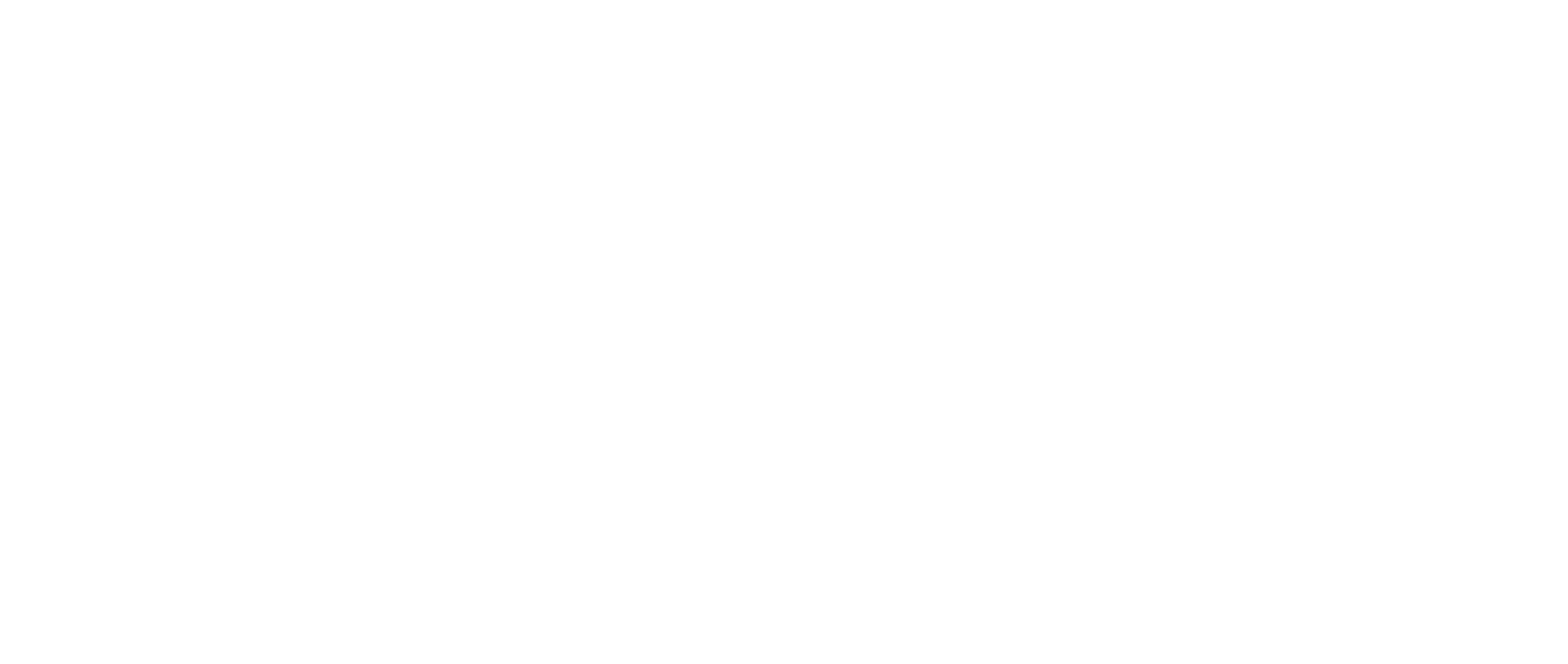Geriatrische Stationen gegen Pflegebedürftigkeit – Warum Altersmedizin mehr ist als Alternsforschung

Mehr als nur „Alternsforschung“
Geriatrie – das klingt für viele immer noch nach etwas zwischen Seniorenbetreuung und medizinischer Nischenkompetenz. Doch dieser Eindruck täuscht. Die Altersmedizin ist heute ein hochspezialisiertes, interdisziplinäres Fachgebiet mit enormer gesellschaftlicher Relevanz. Denn es geht nicht darum, wie Menschen möglichst lange leben – sondern wie sie im hohen Alter möglichst selbstbestimmt leben können.
Die Geriatrie beschäftigt sich nicht mit Schönwetter-Fragen der Langlebigkeit, sondern mit den harten Realitäten des Alltags: Wie wird ein 80-Jähriger nach einem Sturz wieder mobil? Wie kann jemand mit mehreren chronischen Erkrankungen und komplexer Medikation – etwa bei Demenz, Diabetes und Parkinson – trotzdem zuhause leben? Welche kleinen medizinischen, therapeutischen oder digitalen Stellschrauben machen den Unterschied zwischen Pflegebedürftigkeit und Selbstständigkeit?
In der aktuellen WeCareTech Podcastfolge spricht Amir Humanfar mit Prof. Dr. Michael Denkinger genau über diese oft unterschätzte Rolle. Im Gespräch macht Denkinger anhand konkreter Fallbeispiele deutlich, wie viel Potenzial in der Geriatrie steckt – und warum sie längst mehr sein sollte als ein Randthema im Gesundheitswesen.
Ein Bollwerk gegen Pflegebedürftigkeit
Pflegebedürftigkeit gilt oft als unausweichliche Folge des Alterns – doch genau hier setzt die Geriatrie an: nicht erst dann, wenn nichts mehr geht, sondern präventiv, funktionserhaltend und zielgerichtet. Wer frühzeitig geriatrisch betreut wird, muss nicht zwangsläufig ins Pflegeheim. Denn die Altersmedizin fragt nicht: „Was fehlt?“ – sondern: „Was ist noch möglich?“
Geriatrische Teams vereinen medizinische Behandlung, pflegerisches Know-how, Physiotherapie, Ergotherapie und sozialdienstliche Unterstützung – mit einem Ziel: Fähigkeiten erhalten, Lebensqualität zurückgeben. Ob es darum geht, wieder allein auf die Toilette gehen zu können, eine kurze Gehstrecke zu schaffen oder das Entlassmanagement so zu organisieren, dass jemand in die eigene Wohnung zurückkehren kann – das sind keine kleinen Erfolge. Das sind die entscheidenden Weichen, wenn es darum geht, Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Die Geriatrie wird damit zum unsichtbaren Schutzschild im System – und spart am Ende nicht nur Kosten, sondern auch Abhängigkeit, Leid und Hilflosigkeit.
„Ein guter Internist kann das doch auch.“
Ein Satz, der oft fällt – und doch völlig verkennt, worum es in der Geriatrie wirklich geht. Denn Altersmedizin ist keine bloße Verlängerung der Inneren Medizin, sondern ein eigenständiges, funktionsorientiertes Fachgebiet. Es reicht nicht, Symptome einem Organ zuzuordnen. Es geht darum, Wechselwirkungen zu verstehen – zwischen Erkrankungen, Medikamenten, funktionellen Einschränkungen und Lebensrealitäten.Geriatrische Patient*innen haben selten nur ein Problem. Meist bringen sie mehrere chronische Erkrankungen mit, dazu kognitive Defizite oder psychische Belastungen. Wer damit umgehen will, braucht mehr als Fachwissen: Es braucht einen anderen Blick. Ein anderes Denken. Und ein Team.
Gerade erst begonnen – und schon überfällig
Trotz ihres offensichtlichen Nutzens ist die Geriatrie in Deutschland noch relativ jung – gerade mal 40 Jahre alt. Sie kämpft nicht nur mit Strukturen, sondern auch mit Vorurteilen. Einen eigenen Facharzt gibt es bis heute nicht – stattdessen nur eine Zusatzweiterbildung, oft in nur eineinhalb Jahren. Nicht immer mit der nötigen Tiefe, wie Prof. Denkinger betont.
Die Geriatrie steht vor denselben Herausforderungen wie viele Innovationen: Sie verändert eingespielte Muster – und genau das macht sie unbequem. Sie fordert ein Umdenken, in der Ausbildung, in der Krankenhausplanung, und auch in der Politik. Denn was nützen die besten Hüft-OPs, wenn die Patientin danach nicht mehr aus dem Bett kommt?
Digitale Unterstützung für mehr Geriatrie-Verständnis
Mit der wachsenden Bedeutung der Geriatrie steigt auch die Relevanz digitaler Lösungen, die den Stationsalltag älterer Menschen individuell unterstützen. Genau hier setzt Livy Care an: als digitaler Mitbewohner, der Sicherheit schafft, mitdenkt – und Risiken erkennt, bevor sie zu Problemen werden. Das System erfasst unter anderem Bewegungsmuster und löst automatisch präventive Alarme aus, wenn etwa sturzgefährdete Personen aus dem Bett aufstehen. So lassen sich schwere Sturzfolgen gezielt vermeiden – gerade in der sensiblen Phase, in der Mobilität erst wieder schrittweise gefördert und stabilisiert werden muss. Livy Care macht Risiken sichtbar, bevor sie eskalieren – und wird so zur stillen, aber wirksamen Unterstützung im geriatrischen Versorgungsalltag.
Ein Appell an die Zukunft
Was die Pädiatrie für Kinder ist, ist die Geriatrie für ältere Menschen. Sie darf kein Nebenschauplatz bleiben – sondern gehört in den Mittelpunkt medizinischer Versorgung. Ihre Perspektive ist nicht optional, sie ist überlebenswichtig. Denn in einer älter werdenden Gesellschaft geht es nicht nur darum, wie lange wir leben. Sondern vor allem: wie. Umso wichtiger sind Partner, die dieses Verständnis teilen und technologisch umsetzen. Livy Care tut genau das: als gezielte Ergänzung – dort, wo Risiken hoch und Zeitfenster entscheidend sind.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Versorgung von morgen zu gestalten. Buchen Sie jetzt eine unverbindliche Beratung – und entdecken Sie, wie Livy Care den Alltag auf geriatrischen Stationen verlässlicher und vorausschauender macht.